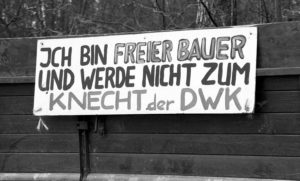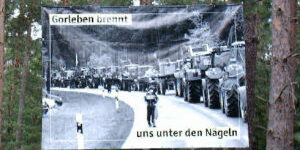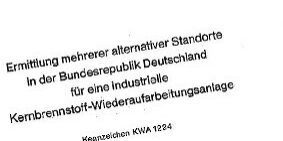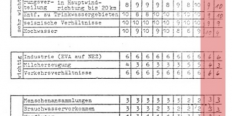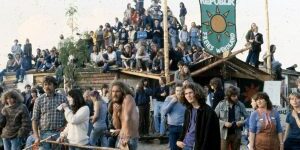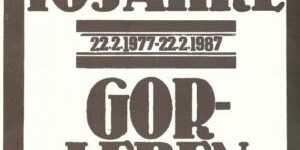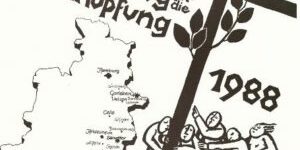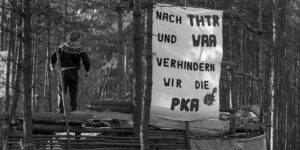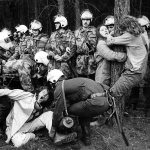

























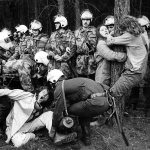






GORLEBEN-CHRONIK
Das Jahr 1984
Der erste "Tag X"
Ein Jahr von großer Bedeutung für die Zukunft des Atomprogramms im Wendland, "das Vertrauen hat sehr gelitten". Menschenkette und Wendland-Blockade gegen die WAA-Pläne in Draghan. Unter erheblichem Protest erreicht ein erster Atommülltransport das Fasslager Gorleben.
März
12.03.1984
Quelle: u.a. SPIEGEL, 18.03.1984
19.03.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
Menschenkette Hitzacker - Clenze
24.03.1984
30.03.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
April
28.04.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
Wendlandblockade
30.04.1984
Mai
19.05.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
Juni
17.06.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
Juli
Im Sommer machen "wie in einem Amoklauf" diverse Staatsanwaltschaften Jagd auf die gelben "Tag X"-Plakate. BI- und Parteibüros sowie Druckereien in Hannover, Göttingen, Lüneburg, Lüchow und anderen Städten werden durchsucht, AKW-Gegner*innen im gesamten Bundesgebiet mit Strafverfahren überzogen. Wer dieses Plakat zu Hause hatte oder gar in die Öffentlichkeit hängte, musste mit strafrechtlichen Maßnahmen rechnen. Der Vorwurf: ein angeblicher "Aufruf zur Gewalt". Das Ziel: Nicht nur die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg e.V. als Herausgeberin sollte kriminalisiert und damit mundtot gemacht werden.
Martin Mombaur, ehemaliger Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz und 1985 Landtagsabgeordneter, übernimmt mit einer Landtagskollegin die alleinige Verantwortung für das Plakat.
28.07.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
August
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
September
25.09.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
Oktober
Tag X
08.10.1984
Am Abend verbreitet sich das Gerücht, dass am Folgetag erneut ein Transport von Stade nach Gorleben stattfinden soll. Zahlreiche Straßenblockaden mit quergestellten Fahrzeugen, Baumstämmen und brennenden Strohballen werden vorbereitet.
09.10.1984
Unter der Lieferung befinden sich falsch deklarierte Fässer aus dem Transnuklear-Skandal. In die als schwachradioaktiv deklarierten Atommüllfässer war illegal hochradioaktives Plutonium beigemischt worden.
Marianne Fritzen, Vorsitzende der BI, 2014 in der Gorleben-Rundschau
10.10.1984
10.10.1984
13.10.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
15.10.1984
Quelle: Lieber aktiv als radioaktiv II, LAIKA-Verlag
31.10.1984
Die ganze Geschichte:

2001
Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005
25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009
Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024
Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981
Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.

2001
Zwei Atommülltransporte rollen nach Gorleben, einer im März, ein zweiter im November. X-tausend Menschen stellen sich quer und WiderSetzen sich. Der Betonblock von Süschendorf zwingt den Castor zum Rückwärtsgang. Der Widerstand bekommt ein Archiv, die Bundestagsabgeordneten ein Denkmal, die „Gewissensruhe“.

2005
25 Jahre nach der „Republik Freies Wendland“ und 10 Jahre nach dem ersten Castortransport ist die Entsorgung des Atommülls weiter ungelöst. In die Debatte um die Entsorgung des Atommülls und die Zukunft der Atomenergie kommt Bewegung, die Veränderungssperre für den Salzstock wird verlängert. Container brennen, Bauern ziehen sich aus – und im November rollt der nächste Atommüllzug ins Zwischenlager.

2009
Brisante Enthüllungen: Gorleben wurde aus politischen Motiven zum Endlagerstandort. Seit Jahren wird nicht nur „erkundet“, sondern ein Endlager gebaurt. „Mal so richtig abschalten“ – ein Protest-Treck aus dem Wendland führt zu einer großen Demo gegen AKW-Laufzeitverlängerung nach Berlin. Kein Castortransport, seit Oktober finden jeden Sonntag Spaziergänge um das Bergwerk statt.

2024
Die BI fordert einen Transportestopp ins Fasslager und den Neubau der Zwischenlagerhalle aus Sicherheitsgründen, denn die Castoren werden noch lange hier bleiben müssen. Der „Rückbau“ des verhinderten Endlagers wird immer teurer, Ende November beginnt dann endlich das Zuschütten: 400.000to Salz kommen zurück unter die Erde. Ein Meilenstein.

1981
Gorleben-Hearing in Lüchow zum Bau des Zwischenlagers und massiver Protest gegen das AKW Brokdorf. Nach Bohrungen werden die Zweifel an der Eignung des Salzstock Gorleben für ein Endlager „größer, nicht kleiner“. Doch Gegner*innen des Projekts seien „Schreihälse, die bald der Geschichte angehören“, meinen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Oppositionsführer Helmut Kohl.